Doping in der BRD – 1950 bis 1969
Siehe hierzu die Anfang August 2013 veröffentlichte Teilstudie des Forschungsprojektes „Doping in Deutschland…“ der Universität Münster
>>> Inhaltlicher Bericht der WWU Münster „Sport und Staat“ (pdf 940-KB)
Reglements/Definitionen/Mittel 1950-1970
erste Reglements
Prof. Michael Krüger 2003:
„Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte nahtlos an die medizinische Forschung vergangener Jahre angeknüpft werden. „Es ist eine Tatsache, dass nach jedem Krieg der Gebrauch von Dopingmitteln vor allem im Radsport erheblich anstieg und dass diejenigen Substanzen zur Anwendung kamen, die vorher von den Soldaten quasi getestet wurden – Amphetamine, aber beispielsweise auch Kokain“.Erik Eggers:
„Hatte bis dahin der bürgerliche Sport westeuropäischer oder angelsächsischer Prägung den olympischen Sport dominiert, war der Eintritt der Sowjetunion in das Internationale Olympische Komitee mit der Sorge des Establishments verbunden, der Kommunismus werde den Weltsport im Handstreich usorpieren. Es entstand das was der Sportwissenschaftler John Hoberman den Mythos von der kommunistischen Sportwissenschaft nennt, das Bild des Sowjetsportler als ferngesteuerten Sportroboter. 1954 erschienen erste Berichte, nach denen sowjetische Sportler mit Anabolika arbeiteten. Jedenfalls war sich 1955 nicht nur IOC –Präsident Avery Brundage sicher, dass die Sowjetunion die größte Sportlerarmee aller Zeiten aufbaute.“Dr. Ludwig Prokop, Sportärztekongress Berlin 1952:
„Für die moralische und sportliche Seite des Dopings hört man von Sportärzten oft die Meinung, dass die Verwendung von Dopingmitteln, soweit sie nicht gesundheitsschädlich sind, fast als eine ,nationale Notwendigkeit‘ bei großen internationalen Wettkämpfen anzusehen ist, weil es die anderen auch machen.“Doping ist nach Ludwig Prokop 1959 ein
„Unerlaubter Versuch durch Zufuhr von Giftstoffen den Körper zu einer besseren Leistung aufzupeitschen. Doping wirkt meist nur auf das Nervensystem, schädigt bei längere Verwendung den Körper und führt oft auch zu moralischem Verfall. Es wir am häufigsten in der Schwerathletik und bei Dauerleistungen (Radfahren) verwendet. Typische Dopmittel sind Morphium, Kokain, Pervitin, Benzedrin, Atropin, Strychnin; an der Grenze stehen die Herzmittel Cardiazol, Sympatol, Coramin und Coffein. Völlig untaugliche Mittel sind Alkohol und Nikotin.“
An anderer Stelle erwähnt er auch Keimdrüsen- und Nebennierenrindenhormone und warnt davor.
Der Deutsche Sportärztebund sah sich gezwungen, eine deutliche Haltung gegen Doping einzunehmen und verabschiedete am 18. Oktober 1952 eine Erklärung, durch die Doping in Wettkämpfen verboten werden sollte:
„Die Einnahme eines jeden Medikaments – ob es wirksam ist oder nicht – mit der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist als Doping zu bezeichnen.“
Als Anlass dieser Erklärung gilt der bereits erwähnte Dopingvorfall bei der Ruder-DM, auf der Olympiaarzt Dr. Martin Brustmann – ‚Fachmann auf dem Gebiet pharmazeutischer „Betriebsstoffe für Willensanstrengung“‚ – den beiden besten deutschen Achtern Dopingmittel verabreicht hatte. (der Spiegel, 16.7.1952) Im Kommentar zu der verabschiedeten Dopingdefinition hieß es:
„Sämtliche Stoffe, die unmittelbar vor der Leistung gegeben werden, sind aus folgenden Gründen Doping: Wenn sie wirksam sind, stellen sie eine unphysiologischen Reiz dar. Sie sind also gesundheitsschädigend. Wenn sie unwirksam sind, sollen sie dem Sporttreibenden das Gefühl der Überlegenheit geben, sie sind also unsportlich. Das Entscheidende aber ist der Dolos, die Absicht, mit der diese Medikamente verabreicht werden, nicht das Medikament selbst. In beiden Fällen soll dem Sporttreibenden ein unberechtigter, unsportlicher Vorteil über den Gegner gegeben werden.“
Körpereigene Stoffe wie Traubenzucker durften gegeben werden. (nach Eggers, 2006) Diese Dopingbestimmungen des Deutschen Sportärztebundes galten noch 1970.
Der Deutsche Sportbund DSB übernahm im April 1953 diese Erklärung der Deutschen Sportärzte. (u. a. die Zeit, 7.8.1970, Keul).
Dass international das Dopingproblem drängte, zeigt das Beispiel Italien und Radsport, hier hatte der Missbrauch, insbesondere der von Amphetaminen, solche Ausmaße angenommen, dass 1954 die Polizei zum Einsatz kam. Anläßlich eines Radrennens der Amateure gab es unter Aufsicht eines Arztes eine Polizeirazzia. Der Arzt, der die gefundenen Flüssigkeiten selbst ausprobierte bevor sie in ein Labor gebracht wurden, soll daraufhin drei Tage unter schweren Kolliken gelitten haben. 1954 kam es nach den Radweltmeisterschaften der Amateure gegenüber den Teamleitern, Bahn und Straße, zu öffentlichen Dopinganschuldigungen, weshalb eine Untersuchungskommisssion eingerichtet wurde. Und schließlich wurde zwischen dem Italienischen Radsportverband und dem Verband der italienischen Sportmediziner 1955 beschlossen, dass ab sofort jeder Fahrer sich vor jedem Rennen einer Untersuchung zu stellen habe. Alarmierende Berichte sind auch aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden bekannt. Möglich, dass es in der Bundesrepublik nicht viel anders war, denn
„1956 nahm der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) erstmals Dopingbestimmungen in sein Reglement auf, allerdings ohne bestimmte Dopingsubstanzen beim Namen zu nennen.“ (idw, 12.11.2003)
Internationale und nationale Regelungen gab es in den 1950er Jahren in folgenden Verbänden:
„Als erste internationale Verbände, welche Doping verbieten und Strafen festlegen, gelten der internationale Amateurboxverband (1951) sowie die IAAF, die bereits seit 1928 ein in der Forschung bis zuletzt wenig beachtetes Dopingverbot in ihren Regularien verankert hatte (vgl. Laure, 2006, S. 121; Vettenniemi, 2010, S. 405ff.). Zu ergänzen wäre mindestens der Internationale Fechterbund, der 1950 bereits eine Anti-Dopingregel besitzt (vgl. Deutscher Fechterbund, 1950, S. 51f). In Deutschland nimmt, als Reaktion auf auch die UCI zu verstärktem Anti-Doping motivierende Dopingvorfälle bei der Tour de France (vgl. Illustrierter Sport-Kurier vom 8.8.1955; Welt vom 21.7.1955; Kölnische Rundschau vom 21.7.1955; Spiegel vom 3.8.1955; Radsport vom 30.8.1955, S. 2; 29.11.1955, S. 9), der Bund Deutscher Radfahrer 1956 Dopingbestimmungen in seine Sportordnung auf (vgl. Ziffer 243 der Wettfahrbestimmungen des BDR 1956). In den amtlichen Leichtathletikbestimmungen des DLV von 1959 findet sich ebenfalls ein Paragraph zum Thema Doping. 1955 fanden in Italien im Kontext einer empirischen Erforschung des Phänomens Dopingkontrollen bei Radrennen statt. Sie führten zur Anti-Dopingkonvention des italienischen Sportärztebundes (Federazione Medico-Sportiva Italiana) und des italienischen Radfahrerbundes (Unione Velocipedistra Italiana). Dies stellte die erste Anti-Dopingkonvention weltweit dar (vgl. Dimeo, 2007, S. 13, 90).“ (Univ. Münster, Sport und Staat, S. 9)
Eggers, 2006:
„In der deutschen Sportwissenschaft köchelte der Dopingdiskurs [1950er Jahre] weiter. Ständig warnten Ärzte Athleten vor dem Gebrauch von Reizmitteln wie Koffein, Pervitin, Morphium oder Kokain. Ein fürwahr schreckliches Sittengemälde der damaligen Verhältnisse zwischen Leistungsportlern und Sportärzten malte der Münchner Sportarzt Friedrich 1955 in der Zeitschrift Sportmedizin. Wenn man als Arzt mit Sportlern von Leistungssteigerung spreche, verriet Friedrich, dann erwarteten „gut 95% der Sporttreibenden, dass man ihnen irgendwelche Tabletten, Pillen oder Tropfen nennt, die sie im Handumdrehen zum Olympiasieger werden lassen.“ Friedrich zufolge wurden im Leistungsport der 1950er Jahre mit Alkohol, Koffeinpräparaten, Strychnin, Adrenalin, Morphium, Heroin, Kokain, Hormonen, Sedativa, Coramin, Cardiazol, Cardiazoltraubenzucker, Benzedrin, Ortegrine und Pervitin nachgeholfen.“
Sportarzt Fischbach griff 1955 die oben erwähnte Forderung nach einer Dopingliste auf und forderte die Einrichtung einer Dopingkommission beim Deutschen Sportätztebund und eine internationale Abstimmung, allerdings vergeblich. Pharmakologe Soehring wies 1957 daraufhin, dass es Möglichkeiten des Dopingnachweises über den Urin gebe und Bliesener forderte die Einführung von Kontrollen vor, während und nach großer Wettkämpfe. (Eggers, 2010)
Eggers, 2010:
„Festzuhalten ist, dass eine ganze Reihe von Sportärzten und Wissenschaftlern das Dopingproblem öffentlich thematisierten und auch konkrete Lösungsvorschläge diskutierten bzw. anboten. Soweit überschaubar, hat sich die renommierte Freiburger Sportmedizin für diesen diffizilen Themenkomplex allerdings eines Kommentars zu diesen heiklen Fragen enthalten, ebenso die Sportverbände. Ebenso wenig haben sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Trainer, Betreuer und Sportler zum Dopingproblem geäußert. Warum diese Akteure des Sports zu diesem Problem schwiegen, wird noch zu erörtern sein. Eine ernsthafte Debatte über diese Lösungsvorschläge aus der Wissenschaft bzw. aus der Sportmedizin wurde erst geführt, als der dänische Radfahrer Knud-Enemark Jensen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wegen Amphetamin-Missbrauchs ums Leben kam.“
Zu Jensens Tod ist jedoch anzumerken, dass sein Tod von Beginn an mit Amphetaminen in Zusammenhang gebracht wurde, da die dänische Mannschaft angeblich entsprechnde Injektionen erhalten hatte, doch es wurden hierzu nie belastbare Beweise vorgelegt. Der Autopsiebericht fehlt. Wahrscheinlich ist, dass die Hitze und mangelnde Trinkmöglichkeiten den wesentlich mit verschuldet hatten. Jensens Tod wurde jedoch schnell über Jahrzehnte hin als willkommener Beweis für die Gefährlichkeit des Dopings genutzt.
In dem zusammenfassenden Abschlussbericht der Studie ‚Doping in Deutschland…‘ der Münsteraner Forscher wird zu der Dopingdefinition des Deutschen Sportärztebundes und des DSB festgehalten, dass nicht allein das Gesundheitsargument wichtig war, sondern auch die Chancengleichheit und Fairplay in die Diskussion eingegangen waren. Sie halten auch fest, dass diese Definition vor allem als moralischer Appell an die Sportler gedacht war, auf Doping im Wettkampf zu verzichten und weniger als Grundlage für Sanktionierungen.
„Dass Dopingsubstanzen als „unsportlich“ gekennzeichnet wurden, stellt ein zentrales Charakteristikum der Definitionsansätze der 1950er-Jahre dar. Demnach handelt es sich bei Dopingmitteln um „körperfremde“ Substanzen, die, wie zu dieser Zeit bei den sogenannten „Reizmitteln“ (Stimulanzien und Aufputschmittel) üblich, unmittelbar vor Wettkämpfen Anwendung finden. Während diese Argumentationslinien weitgehend mit denen moderner Dopingregularien wie dem WADA-Code einhergehen, zeigt sich, dass man 1952 noch stärker auf die Motivation bzw. Intention des Athleten rekurrierte: „Das Entscheidende aber ist der Dolus, die Absicht, mit dem diese Medikamente verabfolgt werden, nicht das Medikament selbst“ (…) Die Intention des Athleten zum Kern der Dopingdefinition zu machen, stellt einen völlig anderen Ausgangspunkt dar als bei der seit Mitte der 1960er-Jahre gängigen enumerativen Definition von Doping über eine Liste. … Die Definition von 1952 zielte damit nicht auf rechtliche Handhabbarkeit ab und eignete sich demnach auch nicht für die Praxis der Dopingverfolgung oder Dopingsanktionierung. Sie stellte vielmehr eine genuin moralische Definition dar, der eine gesinnungsethische Grundposition zugrunde lag.“
Rechtslage – staatliche Gesetzgebung 1950/60er Jahre
Bei der Vorstellung der ersten Zwischenergebnisse des BISp-Forchungsprojektes analysierte Yasmin Wisniewska die ‚Rechtlichen Aspekte des damaligen Dopings in der präanabolen und anabolen Phase von 1950 bis 1972‘. Insbesondere betrachtete Sie die Rechtmäßigkeit der Forschungen Wegeners mit Pervitin in den 1950er Jahren. 2013 erscheint ihre Analyse in ersten Band von „Doping in Deutschland‘ Geschichte, Recht, Ethik. 1950-1972. Die sportrechtlichen Fragen, sportrechtliche Reglements und Implikationen werden in dieser Studie nicht betrachtet. Entsprechende Informationen hierzu finden sich in dem Abschlussbericht der Münsteraner Forscher.
Wisniewska hält u. a. fest:
– „… dass es einem Arzt nach damaliger Rechtslage nicht erlaubt war, einem gesunden Athleten aus Gründen der erwünschten Leistungssteigerung Betäubungsmittel wie beispielsweise das Pervitin zu verschreiben. …“
– „… dass auch der ärztlichen Verschreibung von Arzneimitteln an Gesunde, mit der Absicht einen Dopingzweck zu erreichen, in dem für die erste Projektphase relevanten Zeitraum gesetzliche Grenzen gesetzt waren.
– Ihr Resüme:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ärzte und Apotheker durch das damals geltende Standesrecht sowie das Betäubungs- und Arzneimittelrecht, auch wenn dieses inhomogen und zersplittert war, im Hinblick auf ihre Handlungsmöglichkeiten an die gesetzlichen Bestimmungen gebunden waren und Doping in diesem Sinne nicht erlaubt war. Das Strafrecht bot in dem Bereich der geheimen oder gar gewaltsamen Gabe von Dopingmitteln und bei der freiwilligen Einnahme des Athleten ohne hinreichend aufgeklärt worden zu sein, ausreichende Mittel zur Ahndung von Doping. Doch auch mit einer Verschärfung des Betäubungsmittelrechts hätte dem Doping durch den Bundesgesetzgeber schon frühzeitig Einhalt geboten werden können. … Sinn und Zweck der Betäubungsmittelgesetzgebung war es, die Gesundheit des Volkes zu schützen und insbesondere Suchtkrankheiten zu vorzubeugen. Die zum Doping eingesetzten Mittel waren nicht alle in der Betäubungsmittelliste vertreten, obwohl die große Gefahr der Suchtgewöhnung, das hohe Missbrauchspotential und vor allem die gravierenden gesundheitlichen Schäden durch die Einnahme von Dopingmitteln genug Anlass geboten hätten, die Betäubungsmittelliste dahingehend zu erweitern. … „
Ein eigenständiges Anti-Doping-Gesetz wurde in der Bundesrepublik jedoch nicht geschaffen. Die Münsteraner Forscher halten dazu fest:
„Im Gegensatz zu eher zentralistisch regierten Ländern wie >>> Frankreich oder >>> Belgien, die 1965 ein Anti-Dopinggesetz verabschiedet hatten, sowie in bewusster Abkehr vom NS-Sport und in demonstrativer Abgrenzung zum Staats- und Parteisport der DDR war in Westdeutschland nach 1945/49 der „unpolitische“, staatsferne Sport in Vereinen und Verbänden postuliert worden.“
„Als im Sommer 1965 eine Einladung des Europarats an die europäischen Regierungen zu einer Dopingtagung in Straßburg erging, wurde das zuständige Bundesministerium des Innern (BMI) aktiv und bat nicht nur den DSB bzw. den Deutschen Sportärztebund, einen Vertreter zu entsenden (vgl. BMI an Reindell vom 10.8.1965, in BArchiv Koblenz, B 322/9), sondern schickte selbst einen Regierungsrat. Der Freiburger Sportmediziner Dr. Keul wurde aufgefordert, dem BMI einen „Bericht über Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sowie den Stand der Anti-Doping-Maßnahmen in der Bundesrepublik“ zu senden (BMI an Keul am 10.8.1965, in BArchiv Koblenz, B 322/9).
In welche Richtung die Empfehlung des Sportärztebundes gehen sollte, wurde vom zuständigen Beamten des BMI auch sogleich vorgegeben, indem man insistierte, „so lange wie möglich mit anpassungsfähigen und praxisnahen Verbandsregelungen aus[zu]kommen“, bevor man sich „für den Weg der Gesetzgebung entschließt“ (BMI an Keul vom 10.8.1965, in BArchiv Koblenz, B 322/9).
Keul antwortete, dass es in Deutschland bisher keine einheitlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Dopingvorfällen gäbe. Dies sei darin begründet, dass bei „den meisten der an den Deutschen Sportbund angeschlossenen Verbände […] auch besondere Maßnahmen nicht erforderlich [sind], da eine Gefahr des Dopings nicht besteht. Es wäre aber wünschenswert, wenn trotzdem der DSB generell das Doping verbieten würde“ (Keul an BMI am 16.8.1965, in BArchiv Koblenz, B 322/ 9).
Als ein Ergebnis der Straßburger Tagung (vgl. Weidemann, 1966, 49f.; Reindell, 1966, 45f.; Nielsen, 2011, 50f.) sah das BMI die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit von Sport und Staat in der Anti-Doping Politik als notwendig an, da „unverzüglich im Bereich der Sportverbände sowie auf staatlicher Ebene international zu koordinierende Anti-Doping-Maßnahmen im Bereich des Sports getroffen und durchgesetzt werden sollten.“ Vorrangig sei dies jedoch Aufgabe der Spitzenverbände (BMI an Reindell am 27.9.1965, in BArchiv Koblenz, B 322/9).
>>> Bericht des Europarats über die Tagung in Straßburg vom 23. – 25. September 1965
Auf dem wenige Tage nach der Straßburger Konferenz stattfindenden Doping-Symposium des DSÄB in Berlin referierte Bundesanwalt Kohlhaas über „Gesetzliche Grundlagen für ein Verbot des ‚Dopings‘“. Er plädierte in seinem Vortrag für sportinterne Lösungen und warnte den Gesetzgeber davor, durch legislative Maßnahmen aktiv zu werden, zumal die vorliegenden strafrechtlichenBestimmungen ausreichen würden – eine Position, der sich die Bundesregierung in den kommenden Jahren zwar grundsätzlich anschloss, dessen ungeachtet aber weiterhin als Akteur im Anti-Doping in Erscheinung trat.“ (Inhaltlicher Bericht, S. 14, S. 24.)
Dopingdefinitionen und Reglements in den 1960er Jahren
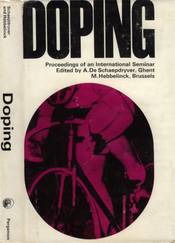
„This volume presents the proceedings of the International Seminar on Doping held at the Universities of Ghent and Brussels on the initiative of the Research Committee of the International Council of Sport and Physical Education, UNESCO, and organized bya committee under the chairmanship of Professor emer. C. Heymans, Nobel Prize Laureate. The seminar was intended as a multidisciplinary approach to the study of the doping problem in the field of sport and physical education. About 50 participants from 10 countries were present at the seminar, which offeredthe advantage of permitting closer scientific contact and of facilitating more free discussion than usually occurs in larger meetings. As a glance at the list of contents on the back flap of this jacket will show, the multidisciplinary approach to the doping J problem is weil reflected in the papers presented, which dealt with the pharmacological, biochemieal, psychological, ethical, social and judicial aspects of doping.“
In den 1950er Jahren wurde Doping mit Aufputschmitteln immer verbreiteter. Das setzte sich in den 60er Jahren fort. Beobachter, insbesondere Mediziner waren alarmiert durch Vorfälle, in denen in Wettkämpfen auffälliges Verhalten zeigten und vor allem durch Todesfälle, wie sie insbesondere aus dem Radsport bekannt wurden. Dass diese Fahrer gedopt hatten und dass solch ein Doping zu verbieten sei, war vielen klar. Es waren jedoch nicht allein die Amphetamine, die beunruhigten. Das Arsenal an Drogen und Medikamenten, das zum Einsatz kam, war groß. Es unterschied sich im Prinzip kaum von dem heutigen. Anabole Steroide fanden zunehmend den Weg in den Sport, Cortison, ACTH, Schilddrüsenhormone, Digitalis und was der Medikamentenschrank sonst so hergab, wurde experimentell eingesetzt.
Doch wie Doping definieren? Zumal es nur eingeschränkte Möglichkeiten der Kontrolle gab bzw. die organisatorischen Voraussetzungen weitgehend fehlten. Sollte Doping auf gesundheitliche Gefahren hin beschränkt werden oder müssten auch sportethische Gesichtspunkte in die Definition einfließen?
Diese Fragen wurden breit diskutiert. Nicht nur Sportler und Mediziner fühlten sich angesprochen. Das Problem gelangte bis in die politischen Gremien. So wurde auf der Ebene des Europarates 1963 eine Expertenkommission gebildet, der neben Vertretern von 10 Mitgliedsländern (auch von West- und Ostdeutschland) Mediziner, Journalisten, Juristen, Sportverbände und Leistungssportler angehörten. Die gefundene Dopingdefinition wurde in Folge auf internationalen Kongressen in Uriage, Madrid und Tokio 1964 anlässlich der Olympischen Spiele abgerundet und (weltweit?) bestätigt. („Doping of athletes, a European survey“, Council of Europe, France, 1963) Insbesondere die Spiele in Tokio hatten vielen das Problem noch einmal verdeutlicht. Laut Prof. Prokop, Leiter des Tokio-Kongresses, war mindestens ein Drittel der Olympioniken dieses Jahres gedopt. Ein Fakt, der jedoch nicht von allen anerkannt wurde. So meinte z. B. der Leiter des Instituts für Leibesübungen an der Universität Freiburg Woldemar Gerschler, er wisse nichts von dem hohen Doperanteil in Tokio und überhaupt sei Doping kein weitverbreitetes Phänomen im Sport, schließlich griffen nur schwache Naturen danach. (Zeitung, Nr. 18, 1964) Gerschler selbst ist jedoch nicht unverdächtig mit Doping experimentiert zu haben (>>> Dopingforschung/Diskussion 1950er Jahre)
Die gefundene Definition ging im Jahr 1967 in >>> eine Resolution ein, mit der die Mitgliedsländer aufgefordert wurden, Einfluss auf ihre Sportverbände dahingehend zu nehmen, dass diese innerhalb von 3 Jahren Antidopingregelungen schaffen. Das Europarat-Dokument von 1967 beinhaltete auch ebenfalls eine Liste verbotener Substanzen, die allerdings gegenüber der Liste von 1963 stark reduziert war. Ob die Anabolika noch Tei de Liste waren, wurde unterschiedlich interpretiert. L. Prokop meinte nein, W. Wolf meinte 1974 ja. (1974 Wolfgang Wolf: Zur Frage des Dopings)
Diese Resolution gilt als erstes internationales Dokument zum Thema Doping.
1965 fügten Österreich, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Italien (seit 1950), Belgien und England über staatliche Regelungen gegen Doping. Die Länder Frankreich und Belgien hatten 1965 ihre Antidoping-Gesetze verabschiedet. Sie hatten sich insbesondere durch den hohen Stellenwert des Radsports und der damit verbundenen Drogenkultur dazu gezwungen gesehen, einzuschreiten. Diese Entwicklungen wurden auch in Deutschland beobachtet. Sportmediziner (mit SS-Vergangenheit) und Journalist Adolf Metzner formuliert hierzu scharfe Kritik (die Zeit, 19.5.1966, die Zeit, 11.11.1966). Die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland hätte es aber nach Yasmin Wisniewska durchaus ermöglicht, mit dem vorhandenen Betäubungs- und Arzneimittelrecht Doping und Dopingforschung, insbesondere mit den vorherrschenden Amphetaminen als Dopingsubstanzen, zu ahnden (s.o.).
Kommentar in der Zeit, 11.11.1966:
„Diese Strafgesetze sind das Ergebnis eines Propagandafeldzuges jener Sportärzte, die mit Ethos triefenden Begründungen gegen das Doping zu Felde zogen und seine Gefahren noch potenzierten. Sie erfochten, wie man richtig schrieb, einen totalen, aber zu totalen Sieg. Für die wirklich kriminellen Fälle dürften nämlich die vorhandenen Strafgesetze ausreichen, und mit den übrigen Fällen sollte die Sportgerichtsbarkeit selbst fertig werden. Die Sportverbände beweisen ja, daß sie dazu auch gewillt sind. Warum also gleich nach dem Staatsanwalt rufen?“
1968 machte das Präsidium des Deutschen Sportbundes, aufgeschreckt durch den Tod des Boxers Jupp Elze einen entsprechenden Vorstoß. Auf Anregung seines Präsidenten Willi Daume hatte es den Beschluss gefasst bei der Bundesregierung ein Antidoping-Gesetz anzuregen. Wieder war es Journalist Metzner, der in einem Kommentar dagegensprach und die Argumente der Gegner dieser Initiative hoch hielt. (die Zeit, 9.8.1968: Gefängnis für Doping?)
Das BMI wandte sich daraufhin 1969 an den DSB, das NOK und den DSpÄB mit Bitte um Vorschläge von Maßnahmen gegen Doping. Siehe hierzu auch 15.11.1968 Dt. Bundestag, Protokoll 196. Sitzung. 5. Wahlperiode .
„Der DSB befragte daraufhin seine Verbände und kam zu dem ernüchternden Ergebnis, dass lediglich vier der 42 angeschriebenen Verbände Antidopingbestimmungen in ihren Satzungen aufwiesen. Damit wurde die weitgehende Wirkungslosigkeit vorangegangener Initiativen deutlich. Zudem wiesen die existierenden Dopingbestimmungen mit Ausnahme der Regelungen im Radsport nur eine geringe Komplexität auf *. Die Regelungen des Deutschen Leichtathletik- und des Deutschen Amateur Box Verbandes umfassten wenige Zeilen und kamen über eine Spezifizierung des Dopingbegriffs, moralische Verurteilung und relativ allgemeingehaltene Sanktionen nicht hinaus. In den Regelungen des DLV und des DABV ist von Dopingkontrollen noch nicht die Rede. Damit waren die formalen Voraussetzungen für eine wirksame Kontrolle und Sanktionierung von Dopingvergehen zu dieser Zeit nicht vorhanden.“ (Meier et al., 2012, Jupp Elze)
(* Zu den Antidoping-Regelungen des BDR s. Universität Münster, Sport und Staat, S. 21 ff).
Letztlich wurde der Antidopingkampf in den meisten Ländern in die Hände des Sports übergeben und damit mehr schlecht als recht umgesetzt. Die internationalen und nationalen Verbände hatten das Recht sich die Anti-Doping-Bestimmungen nach eigenem Gusto zu verordnen. Eine Einheitlichkeit war damit nicht gegeben. Weder was die Liste der verbotenen Mittel und Methoden, noch die damit verbundenen Sanktionen anbelangte. Auch innerhalb derselben Disziplinen konnte es Unterschiede zwischen internationalem Verband und nationalen Verbänden geben. Dieser Wirrwar bestand bis zur Gründung der WADA.
Alexandre de Mérode, Präsident der Medizinischen Kommission des IOC vermerkte in einem Bericht des Jahres 1978, den er im Auftrag des Europarates verfasst hatte, dass dessen Initiative von 1967 verpufft war. Die Staaten hätten das Problem vernachlässigt bis verleugnet. Es gäbe kaum Laboratorien vergleichbarer Qualität und die Verbände, die den Antidopingkampf aufgenommen hätten, seien erfolglos geblieben.
Die medizinische Kommission des IOC hatte bereits nach dem Tod von Knud Enemark 1960 in Rom nach einem internationalen Kontrollsystem verlangt. Erste Kontrollen wurden 1964 in Tokio durchgeführt. 1967 veröffentlichte das IOC seinen ersten ‚Medical Code‘, Kernstück dessen war eine erste Liste mit verbotenen Substanzenklassen und Methoden sowie Sanktionen:
„„Doping besteht aus:
1. der Verwendung von Substanzen aus den verbotenen pharmakologischen Wirkstoffgruppen und/oder
2. der Anwendung verbotener Methoden.“ (Anti-Doping-Handbuch Bd.1) Auf eine weitergehend Dopingdefinition wurde bewusst verzichtet. (Mehr Infos: Patrick Laure, Histoire du Dopage, 2000, S. 163ff)
Auch die UCI reagierte 1967. Nach dem Tod von Tom Simpson etablierte sie ähnliche Maßnahmen einschließlich einer Verbotsliste wie das IOC.
Dopingdefinitionen
Interessante Diskussion zur Doping-Situation 1967
ZDF-Sportspiegel 1967 zum Doping von Tom Simpson: „Das sind alles Heuchler!“
Definition des Deutschen Sportärztebundes vom 18. Oktober 1952:
„Die Einnahme eines jeden Medikaments – ob es wirksam ist oder nicht – mit der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist als Doping zu bezeichnen.“Definition of the Dutch Federation of Medical Sportexamination Centres, 1961:
„In sporting-circles doping is understood to be the application of unnatural means by sportsmen with intent to increase their performances.“
Aufgrund der internationalen Wettbewerbe ergab sich zunehmend die Notwendigkeit einheitliche Definitionen des Dopings zu finden und Listen mit Substanzen und Methoden zu schaffen. Doch sehr viel war über die genauen leistungssteigernden Wirkungen der einzelnen Mittel in den 1960er Jahren immer noch nicht bekannt. Der Sport war ein weites Experimentierfeld. Der Radsport führte dies am intensivsten vor Augen. Daher unternahmen immer mehr Wissenschaftler, überwiegend Mediziner, Versuche, auch Versuchen an Sportlern, um die physiologischen und mentalen Prozesse und Dopinggaben zu erkennen. Die aus Köln und Freiburg bekannte Forschungsrichtung erhielt Zuwachs. Manch eine Studie wäre einige Zeit später aus ethischen Gesichtspunkten nicht mehr akzeptabel gewesen. Dies räumte auch Prof. Manfred Steinbach ein, der u.a. an jugenlichen Sportlern den Einsatz von Anabolika untersuchte (s.u.).
Gefragt wurde nach dem leistungsteigernden Potential und den Auswirkungen auf die Gesundheit. In Medizinerkreisen wurde auch bereits darüber spekuliert, ob medikamentöse Gaben nicht sogar notwendig wären bei höchster sportlicher Leistung, ein Argument, welches in den Folgejahren die Dopingdiskussion beherrschte.
Die Definition des Dopings, die der Europarat (17 Mitgliedsstaaten) nach dem oben beschriebenen Prozess 1963/1967 verabschiedet hatte, lautete:
„Doping ist die Verabreichung oder der Gebrauch körperfremder Substanzen in jeder Form und physiologischer Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Personen mit dem Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung für den Wettkampf. Außerdem müssen verschiedene psychologische Maßnahmen zur Leistungssteigerung des Sportlers als Doping angesehen werden.“
„Wird eine notwendige Behandlung mit Mitteln durchgeführt, die Aufgrund ihrer Natur oder Dosis die körperliche Leistungsfähigkeit über das normale Niveau zu heben imstande sind , so gilt dies als Doping und schließt die Wettkampffähigkeit aus.“ (s.a. Mader, LSB NRW 1977)
der Stern, 30.7.1967:
„Jeder Versuch das Doping im Sport zu bekämpfen, ist bisher ein Schlag ins Wasser gewesen. Staatliche Verbote in Frankreich und Belgien haben ebensowenig ausgerichtet wie eine Empfehlung des Europarates in Straßburg, im Sport freiwillig auf aufputschende Medikamente zu verzichten. Wo die Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Mitteln liegt, ist immer noch Streitobjekt auf medizinischen Kongressen. … Am weitesten hat Professor Ludwig Prokop von der Universität Wien den Vorhang über dem Doping-Unwesen im Sport gelüftet.
Prof. Ludwig Prokop interpretiert den gesamten Text des Europrates (liegt mir nicht vor) und beschreibt damit verbundene Praxisprobleme. Er folgert aus der obigen Definition:
„Der reine Ersatz fehlender oder verausgabter Stoffe, etwa Traubenzucker, Calcium, Lezithin, Phosphate, Eiweißverbindungen und Vitamine, ist demnach kein Doping.“
Er wiederlegt die Annahme einiger Ärzte, die davon ausgehen, Sportler könnten mit Medikamentengaben Wettkämpfe bestreiten sofern eine ärztliche Indikation dafür vorliegt, benennt aber die Schwachstelle.
„In der internationalen derzeit [1968] gültigen Definition heißt es:
„Wird eine notwendige Behandlung mit Substanzen vorgenommen, die auf Grund ihrer Dosis, Natur oder Anwendung die Leistung des Athleten im Wettkampf künstlich oder unfair steigern könnten, gilt dies als Doping und schließt die Wettkampffähigkeit aus.“
Diese Definition hat einen schwachen Punkt: Der Begriff der adäquaten Dosis kann selbst unter seriösen Fachleuten sehr unterschiedlich ausgelegt werden, Dies gilt allerdings nur für Mittel, die nicht expressis verbis auf der internationalen Liste stehen.“
Die Beschlüsse der Internationalen Dopingkommission des Europarates beinhalteten auch Listen von Substanzen die als Dopingmittel zu gelten hatten. Dabei ging die 1963 verabschiedete Liste weiter, als die von 1967. Diese erste Liste beinhaltete noch Hormone, wobei L. prokop und W. Wolf unterschiedliche Meinungen darüber hatten, ob Anabolika in der Liste von 1967 als Dopingsubstanz zu gelten hatten. 1967 nach Gründung der Medizinischen Kommission des IOC wurde sie
„auf ein Minimum reduziert. Sie weist u.a. Alkohol, Hormone, Vitamine, Phosphorverbindungen, Cardiaca, Tranquilizer und Vasosilatantia nicht mehr aus (L. Prokop).“ (W. Wolf, 1974)
Wie schwierig sich die Diskussion um diese Definition gestaltete, wie uneinheitlich deren Anerkennung und erst recht deren Interpretation war, zeigen beispielhaft die Auseinandersetzungen, die sich um die Einordnung der anabolen Steroide als Dopingmittel in Deutschland ergaben. Ende der 1960er Jahre verstärkte sich die kontroverse Debatte, die noch viele Jahre bis weit in die 80er Jahre andauerte und letztlich auch noch nicht mit der Einführung des Testosteronnachweises 1982 beendet war.
Die folgenden Zitate stammen aus dem Text von Ludwig Prokop:
>>> Chemische statt Olympische Spiele ?
Ludwig Prokop, 1966:
„Obwohl die Verwendung von Dopingmitteln in verschiedenen Sportarten auch in Österreich schon längere Zeit bekannt war, kam es erst 1963 zum ersten großen Skandal, als anlässlich der Österreich-Rad-Rundfahrt vor der Großglockner-Etappe bei einer Kontrolle der Trikots bei mehreren österreichischen Spitzenfahrern große Mengen Amphetaminen und anderen Stimulantien gefunden wurden. Der Ausschluss dieser Fahrer löste eine übliche Pressekampagne gegen mich als den Tourarzt aus, weil durch den Ausschluss der Fahrer nicht nur die Österreichische Nationalmannschaft ausfiel, sondern auch die ausschließlich von Firmen finanzierten Vereine sich in ihren geschäftlichen Interessen gestört sahen. Die gleiche Situation ergab sich 1964 und 1965, als verschiedene österreichische und ausländische Fahrer wegen der im Harn nachgewiesenen Stimulantien disqualifiziert und soweit es die österreichischen Fahrer betraf, auch für längere Zeit gesperrt wurden“.
(R. Ronacher, 2007)
Zitat Prokop (1968):
die am häufigsten verwendeten Mittel
„Über 200 verschiedene Mittel werden in den internationalen Listen namentlich aufgeführt; in der Praxis spielt jedoch nur eine kleine Zahl eine Rolle. Am häufigsten verwendet werden:
– Narkotika, vor allem Morphium und Cocain;
– Amphetamine, z. B. Pervitin, Stenamin, Benzedrin;
– pflanzliche Alkaloide wie Strychnin und Ephedrin;
– Analeptika und ähnlich wirkende Substanzen.
Zu den Dopingsubstanzen gezählt werden auch Kardiaka, Respirotonika, Psycholonika, Vasodilatantien sowie theoretisch Corticosteroide und Sexualhormone. …
Anabolika werden im Kraftsport wie Gewichtheben, Ringen, Boxen, Werfen usw. oft in enormen Dosen, auch von Frauen, konsumiert. Rein theoretisch müßten sie bei gesunden Athleten als nicht physiologisch und damit als unerlaubte Unterstützung angesehen werden; doch sind sie derzeit aus zwei Gründen nicht auf die Dopingliste gesetzt worden:
– Sie erbringen keinen unmittelbaren Vorteil für den Wettkampf.
– Sie nachzuweisen, ist sehr schwierig.
Etwas aus der Reihe fällt etwas der Alkohol. Schützen pflegen vor dem Wettkampf oft beachtliche Mengen davon hinunterzuschütten. Als Grenze ist vom Internationalen Fünfkampfverband eine Blutalkoholkonzentration von 0,4 0/00 festgesetzt worden.“
Nachweis von Dopingmitteln in Blut und Harn
Zitat Prokop:
„Die heute [1968] im Leistungssport verwendeten konstitutions-hebenden Pharmaka gehören drei verschiedenen pharmakologischen Wirkgruppen an:
– Symphathikomimetika und Euphorika wie Amphetamin, Methamphetamin, (Pervitin®), Synephrin (Sympatol®) und Stenamin;
– Analeptika, wie Strychnin und Cardiazol®;
– Anabolika, wie Dianabol® und Emdabol®.
Ihre chemische Beschaffenheit ist sehr unterschiedlich, die einen sind Amine; Strychnin gehört zu den Alkaloiden, und Anabolika sind Hormone. Dennoch existieren recht einheitliche Methoden für ihren qualitativen und quantitativen Nachweis in Blut und Harn.
Das eleganteste Verfahren ist heute die chromatographische Konzentration und Auftrennung mit nachfolgender Identifizierung mittels Sprühreagenzien und/oder UV-Licht. Soll die Menge genau bestimmt werden, bedient man sich der Photometrie und UV-Spektroskopie. Jedoch auch hier liefert erst die Chromatographie die Proben. …
Bei Verdacht auf Anabolika trennt man den Harn zweidimensional mittels der Dünnschicht-Chromatographie in einer Chloroform-Azeton-Mischung. Nach dem Trocknen wird die Platte beispielsweise mit 50 %iger Phosphorsäure besprüht und kurz auf 150 °C erhitzt. Erscheinen nun massive Flecken, die bei Tageslicht graubraun, bei UV-Licht von 360 mμ orange sind, so liegt eine anabole Substanz vor.“*
Präparate und ihre Hersteller:
Cardiazol®: Knoll/Ludwigshafen
Dianabol®: Ciba/Wehr (Baden)
Emdabol®: Merck/Darmstadt
Pervitin®): Temmler/Marburg
Sympatol®): Boehringer/Ingelheim (Ende Zitat)
*Anmerkung: Diese Methode kam zu dieser Zeit nicht zum Einsatz. Erst 1974 war ein Test auf die anabol, androgenen Hormone anerkannt. Woraufhin das IOC ein Verbot aussprach. Erste Kontrollen fanden bei den Commonwealth-Spielen statt.
1960:
„Die am häufigsten verwendeten Mittel zum Dopen sind:
– Rauschgifte, in erster Linie Kokain: Sie erhöhen vorübergehend Muskelkraft und Ausdauer;
– Weckamine, zum Beispiel Pervitin: Sie heben das Ermüdungsgefühl eine Zeitlang auf und verbessern die Konzentrationsfähigkeit;
– pflanzliche Gifte, wie Strychnin, Atropin, Ephedrin: Sie regen das Nervensystem an;
– Hormone, vor allem Keimdrüsen – und Nebennierenrindenhormone: Sie beheben Erschöpfungszustände;
– Tranquilizer: Sie beruhigen aufgeregte und nervöse Sportler.“
(der Spiegel, 7.9.1960)
Diskussion um Anabolika
Noch immer galt die Dopingdefinition des Deutschen Sportärztebundes, die 1953 vom DSB übernommen worden war: „Der Deutsche Sportärztebund steht auf dem Standpunkt, dass jedes Medikament – ob es wirksam ist oder nicht – mit der Absicht der Leistungssteigerung vor Wettkämpfen gegeben als Doping zu betrachten ist.“ Legt man diese Definition zugrunde, waren Anabolika, sofern sie zur Leistungssteigerung benutzt wurden, in West-Deutschland verboten. Eine einheitliche Beuteilung und Beachtung dieser frühen DSB-Richtlinie ist jedoch in den 1960er Jahren nicht gegeben.
Ludwig Prokop nennt Anabolika im Zusammenhang mit den am häufigsten benutzten Dopingmitteln. Bereits 1959 zählt er sie als Dopingmittel auf und warnt davor:
„5. Verschiedene Hormone, vor allem Keimdrüsen- und Nebennierenrindenhormone. Die damit erzielte Leistungsverbesserung ist zum Teil durchaus biologisch, wenn eine Unterfunktion dieser Drüsen vorhanden ist. Sie wirken sich dann bei Erschöpfungszuständen oder chronischer Übermüdung, also im Übertraining oft sehr günstig aus. Jede Gabe großer Mengen dieser Hormone ist aber ein gewaltiger Eingriff in fast alle Körperfunktionen und daher sehr gefährlich. Dies gilt nicht zuletzt auch für die oft schon regelmäßig betriebene Verschiebung der monatlichen Regelblutung bel Spitzensportlerinnen durch Eierstockhormone. (>>> L. Prokop, 1959)
1968 erwähnt er, dass sie nicht auf die Dopingliste gesetzt sind, u. a. weil sie ‚keinen unmittelbaren Vorteil für den Wettkampf‘ brächten. Die Praxis sieht zu der Zeit schon anders aus, Sportler dürften bereits andere Erfahrungen gemacht haben.
„Die Flut hervorragender Leistungen bei Stoßern und Werfern, besonders im Diskuswurf (in der DDR kamen schon drei Werfer über 60 Meter), könnte auf Dianaboleinnahme zurückzuführen sein,“
meint Journalist Adolf Metzner und klassifiziert die Hormone in ‚der Zeit‘ vom 2.8.1968 in dem Artikel ‚Sind Anabolica Doping oder nicht?‘ als verboten.
Prof. Manfred Steinbach, Sportarzt und Trainer, wertete 1968 Anabolika ebenfalls als Dopingmittel. Aufgrund einer von ihm durchgeführten Studie mit 125 Jugendlichen und einigen erwachsenen Spitzenathleten des USC Mainz gehörten Anabolka eindeutig zu den verbotenen Mitteln.
„Ausgehend von der Erfahrung, daß männliche Sexualhormone Muskelwachstum und Muskelkraft fördern – Eunuchen sind auffallend muskelschwach -, wurden diese Hormone in jüngster Zeit mit gutem Erfolg verabreicht, aber leider auch mit fatalen Nebenwirkungen in der Sexualsphäre. Vorwiegend synthetische Weiterentwicklungen auf dieser Basis – die sogenannten Anabolica sind weitgehend frei von diesen Begleiteffekten. Man versteht unter Anabolismus das Aktivieren des Eiweißstoffwechsels mit daraus resultierendem Aufbau eiweißreicher Gewebe, zu denen in erster Linie die Muskulatur gehört. In der Tat haben Versuche mit Dianabol eine nachweisbare Verbesserung der absoluten Kraft dieser Muskeln ergeben, die ja jeweils vom Querschnitt abhängt. Es ist sogar möglich, durch Gaben von Anabolika und Training nur bestimmter Gliedmaßenabschnitte Muskeln buchstäblich gezielt und isoliert zu entwickeln. Vereinzelt sind dadurch gewaltige Umformungen ins Athletische erreicht worden, manche Bestleistung der letzten Jahre mag teilweise mit auf dieses Konto gehen. Daß es sich hierbei um Doping, wenn auch ein langfristiges handelt, ist klar. Andererseits wird man einem Atleten im Juni kaum nachweisen könne, daß er im Winter davor Anabolika genossen hat.“ (Bild der Wissenschaft 6, 3 1969)
Helmut Acker, 1972:
„Der von Sehnen- und Bänderzerrungen geplagte Zehnkampf-Rekordler Kurt Bendlin hat schon 1966 Erfahrungen mit Dianabol gesammelt und nach drei Monaten das Präparat wegen starker Gewichtszunahme wieder abgesetzt.“
Steinbach schreibt auch:
„Anabolica zählen nun einmal zum Doping, darum und aus Gründen der aufgezählten Schädigungsmöglichkeiten kann der Athlet nicht genug vor der Einnahme derartiger Präparate gewarnt werden, insbesondere wenn er in der Annahme, es mit absolut harmlosen Substanzen zu tun haben, kritiklos und über lange Zeit unzuträgliche Dosierungen auf eigene Faust riskiert.“ (Steinbach, 1968: Über den Einfluß anaboler Wirkstoffe auf Körpergewicht, Muskelkraft und Muskeltraining)
H. J. Schnell erwähnt in seinem Manuskript „Ethische Aspekte des Dopings in der präanabolen und anabolen Phase von 1950 bis 1972“ einen Sportarzt, der 1968 als Teilnehmer eines wissensschaftlichen Beratergremiums (Jaromir Frič, Jahrestag des DLV-Leistungsrates 1968 – Näheres s. bei Spitzer, 2013), eines olympischen Fachverbandes
„unter Bezugnahme auf „einige Sportler und Trainer“ bezeugte „die Anabolikabehandlung werde „geheim durchgeführt“. Laut Protokoll der Sitzung warnte der Arzt wie folgt: „Anabolika können langfristig schädliche Nebenwirkungen hervorrufen“, und: „Anabolika sind als Dopingmittel zu bezeichnen […]“. „Wegen der möglichen schädlichen Nebenwirkungen wird von der Anabolika Anwendung abgeraten.“
Schnell sieht aufgrund der Geheimhaltung damit bereits in den 1960er Jahren ein Unrechtsbewusstsein gegenüber dem Anabolikadoping für gegeben an. (H. J. Schnell: „Ethische Aspekte des Dopings in der präanabolen und anabolen Phase von 1950 bis 1972“. Präsentation von Zwischenergebnissen des Teilprojektes an der Humboldt-Universität zu Berlin, Leipzig, 25.10.2010 (Manuskript).)
Es liegen weitere Zeugnisse vor, wonach die Gefahren des Dopings mit Anabolika in den 60er Jahren bereits bekannt waren und Sportärzte davor gewarnt hatten: >>> 1970 D. Rosseck und H. Mellerowicz: Nebenwirkungen der Anabolika
Brigitte Berendonk wird 1969 mit ihrem Text >>> ‚Züchten wir Monstren‘ am deutlichsten. Eindringlich schildert sie die weite Verbreitung der Hormone im internationalen Leistungssport, warnt vor Verharmlosungen und vor schweren gesundheitlichen Folgen. Leistungsportlerin Berendonk sah ebenfalls durch die oben zitierte gültige Doping-Definition ein deutliches Verbot der Hormone für gegeben an:
„Nach der weithin akzeptierten Definition von Doping als der bewußten Aufnahme von nicht zur normalen Nahrung gehörenden Substanzen zum Zwecke der Leistungssteigerung ist der Gebrauch von Anabolica Doping. Da beißt keine Maus einen Faden ab!“
Doch welcher Verband hatte überhaupt zu diesem Zeitpunkt bereits diese oder eine ähnliche Definition und Verbotsliste in seine Regularien aufgenommen und damit die Möglichkeit zu sanktionieren?
Diese wenigen Zitate zeigen, dass die Einschätzung der Hormone während dieser Jahre uneinheitlich war. Auch in den Folgejahren sorgten Anwendungen und Umgang damit für Irritationen und heftige Auseinandersetzungen. Anabolika wurden zum beherrschenden Dopingmittel der folgenden Jahre.
Eine Analyse der damaligen Entwicklung des Anabolika-Konsums im internationalen und deutschen Sport sowie der möglichen Gründe für das mangelnde Problembewusstsein haben Andreas Singler und Gerhard Treutlein in ihrem Buch >>> ‚Doping im Spitzensport‘, S. 182ff vorgenommen und kann unter dem angegebenen Link ab S. 182ff gelesen werden. Weitere Informationen sind in ‚G. Spitzer (Hrsg.), Doping in Deutschland, 1950-1972‘ zu finden. Siehe hierzu auch doping-archiv: Diskussion/Beispiele aus den 1960er Jahren.
Ost gegen West, West gegen Ost:
Amateurismus, Doping:
„Dieser [DLV-Vositzender Dr. Danz] war nämlich einer der Initiatoren jener in Budapest erstmals durchgeführten Untersuchung aller weiblichen Teilnehmer. Eine Maßnahme, die auch der ideologischen Medaillenpropaganda des sich auflockernden Ostblocks einen schweren Schlag versetzte. Mehrere Weltrekord-„Damen“ aus der Sowjetunion und eine aus Rumänien, deren Äußeres nicht gerade von fraulichem Liebreiz überströmte, konnten es damals nicht wagen, sich in Ungarn der Ärztinnenkommission zu stellen. Sonst wäre nämlich offenbar geworden, daß ihnen nicht nur weibliche, sondern auch männliche Hormone bei ihren Fabelleistungen Hilfestellung gewährt haben. Kaum hatte man diesen Schlag auf den Unterleib des kommunistischen Prestigesports halbwegs überwunden, da versuchte Dr. Danz eine neue Aktion in Gang zu setzen, die wiederum gewisse Auswirkungen östlicher Ideologie empfindlich treffen mußte. Er forderte nämlich Dopingkontrollen. …“
(Der Krieg der Schuhe, 03.02.1967)
Reglements der Verbände zu Anabolika
> 1953-1993 Anabolika-Reglements
Die nationalen und Internationalen Verbände hatten nur sehr eingeschränkte Machtbefugnisse. Ihre Vorschriften betrafen allein eigene Wettkämpfe und die darin auftretenden Athleten. So konnten die verschiedensten Reglements nebeneinander bestehen und sich auch widersprechen. Das IOC z. B. hatte lediglich Befugnisse hinsichtlich der Veranstaltungen der Olympischen Spiele und damit hinsichtlich der Amateure, die daran teilnahmen. Und die Richtlinien des DSB hatten höchstens appelativen Charakter, Einfluss auf dieren Übernahm in die Verbandsregelungen hatte der DSB damit nicht.
Die besonderen Schwierigkeiten anabole Steroide in den 1960er Jahren als Dopingmittel zu klassifizieren und zu verbieten sind vielschichtig zu diskutieren, siehe hierzu die Ausführung in dem Endbericht ‚Sport und Staat‘ der Münsteraner Forscher 2013, S. 35f.
Die UCI und das IOC (P. Laure, S. 202) hatten Hormone und anabole Steroide, auch Testosteron, ab 1967 verboten. Ausgenommen waren bei der UCI Fahrer, die vor der Kontrolle ein ärztliches Attest vorlegten, beim IOC die Anwendung für ‚medizinische Zwecke. Explizit aufgeführt in der ersten IOC-Liste verbotener Mittel waren sie jedoch nicht. Aufgrund des fehlenden Nachweisverfahrens, insbesondere für Testosteron, wurden sie von der UCI bis zur Neuaufnahme 1978 wieder aus dem Reglement entfernt. Auch das IOC hat die Anabolika 1971 wieder aus dem Verbot wegen der Nichtnachweisbarkeit entlassen (s. M. Donike in Hollmann 1972, S. 226).
Die IAAF verbot die Anabolika 1970. Dieses Verbot wurde vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) kurz darauf übernommen.
1979 präzisierte Donike den Begriff der Nichtnachweisbarkeit dahingehend, dass damit nicht analytische Verfahren gemeint gewesen seien, sondern dass Anabolika einige Zeit vor dem Wettkampftag eingenommen, an diesem nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Laut gültiger Kontrollpraxis wurden Proben lediglich direkt nach den Wettkämpfen durchgeführt, denn
„bei den klassischen Dopingmitteln kann vorausgesetzt werden, daß sie nur dann wirksam sind, wenn meßbare Blutspiegel und in Abhängigkeit davon meßbare Urinspiegel vorliegen. Eine Dopingkontrolle nach dem Wettkampf in Form einer Urinprobe, wie die Satzungen der internationalen Verbände es vorschreiben, reicht also aus, einen Mißbrauch dieser Mittel festzustellen.“ (Donike, 1979)
1974 wurden die Anabolika (ohne Testosteron) explizit in die neue IOC-Verbotsliste aufgenommen, nachdem Nachweisverfahren entwickelt waren bzw. die Kontrollen Tage vor den Wettkämpfen statt fanden. Laut einer Befragung über Anabolika-Gebrauch bei den Olympischen Spielen 1972 nahmen 68 % aller Leichtathletik-Teilnehmer diese Mittel. 1974 führte der IAAF erste Kontrollen auf die synthetisch hergestellten Anabolika, die der Körper nicht selbst herstellen konnte, bei den Hallenweltmeisterschaften durch, das IOC folgte 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal. Das IOC verbot 1982 explizit Testosteron.
Der internationale Leichtathletikverband IAAF formulierte 1970 zum ersten Male Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Dopings als eine Reaktion auf den häufigen Anabolikamissbrauch: Steroide werden verboten, Tests werden gemacht, doch diese werden nur zu Forschungszwecken verwandt.
Dr Leistungsrat des Deutschen Leichtathletik-Verbandes entscheidet sich daraufhin ein Anabolika-Verbot und rät in einer Stellungnahme dem DLV Anabolika analog dem IAAF in die Verbotsliste aufzunehmen. Er argumentiert aber auch mit den Rahmenrichtliniern des DSB, danach entspräche die Einnahme von Anabolika vor und für den Wettkampf dessen gültiger Dopingdefinition, eine Verhütung von Überdosierungen und Nebenwirkungen seien nicht durchführbar, ärztliche Kontrollen zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden seien zu teuer und Trainingskontrollen machbar. „Die Freigabe der Anabolika würde eine Vielzahl anderer chemischer Manipulationen im Training anregen und fördern. Es würde daraus eine weitere Fehlentwicklung im Sport resultieren, die sinnwidrig, ethisch verwerflich und für die Sporttreibenden, insbesondere Jugendliche und Frauen, gesundheitsgefährlich wäre.“ (Leichtathletik, 13.10.1970) Noch im Januar 1970 war aus der Geschäftsstelle des DLV in Reaktion auf Brigitte Berendonks Artikel zu vernehmen, dass von Seiten der Mediziner noch nicht geklärt sei, ob es sich bei Anabolika um echte Dopingmittel handele.
Im März 1971 gibt sich der DLV neue Dopingbestimmungen
>>> 1971 DLV-Dopingbestimmungen
Darin heißt es u.a.
„Doping ist der Versuch, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit des Sportlers durch unphysiologische Substanzen für den Wettbewerb zu erreichen.
Man versteht darunter die Anwendung (Einnahme, Injektion oder verabreichung einer Dopingsubstanz durch Sportler oder deren Hilfspersonen (insbesondere Mannschaftsleiter, Trainer, Betreuer, Ärzte, Pfleger und Masseure) vor, während oder unmittelbar nach dem Wettkampf.“
Anabolika sind in der angehängten Medikamenten-Verbotsliste namentlich aufgeführt und auch im Training verboten (Anaboleen/Dianabol/Durabolin/Emdabol/Oranabol/Primobolan/Steranabol/Stromba) Die Liste wird als nicht vollständig klassifiziert, in Zweifelsfällen habe der der Rechtsausschuss nach Anhörung der Doping-Kommission zu entscheiden. Waren damit auch Testosterone verboten? Theoretisch wohl schon, praktisch aufgrund fehlender Nachweisbarkeit eher nicht. Ein Problem, dass dem Testosterondoping in den Folgejahren breiten Raum verschaffte.
Die folgende allgemeine Stellungnahme von Karlheinz Gieseler, DSB-Hauptgeschäftsführer, aus dem Jahr 1970 kann erklären, warum in den Folgejahren die Doping-Diskussion im deutschen Sport geprägt war durch Unschärfe der Argumente und breiten Interpretationsmöglichkeiten.
„Willkürliche Festsetzung einer Gruppennorm ist völlig legitim und natürlich im Sinne von üblich. Doch muß man gewisse pragmatische Regeln befolgen: 1. Nichts verbieten, was nicht unbedingt verboten werden muß. 2. Ein bestehendes Verbot konsequent durchführen. 3. Kein Verbot, wo keine Kontrollmöglichkeit besteht. Nichtbeachtung dieser Regeln führt oft zur Aufweichung des Normensystems einer Gruppe. …
schon in der gerafften Begriffsbestimmung des Dopings aus der Konvention des Europarates mit vielen allgemeinen Formulierungen wie gesund, ungewöhnlich, künstlich wird erkennbar, wie weit man noch von gerechten Lösungen zur Bekämpfung dieses Mißstandes entfernt ist. Um festen Boden unter die angestrebten Maßnahmen zu bekommen, sollte deshalb der erste Schritt auf die wirklich ernsthaften und gesundheitsschädigenden Manipulationen durch das Doping beschränkt werden. In der Dopingfrage ist noch vieles in Bewegung. Manches, was heute gelegentlich unter Doping gezählt wird, fällt wirklich nicht darunter. Wer zum Beispiel — wie es nicht selten geschieht — auch die psychologische Führung des Athleten einbeziehen will, geht weit am Problem vorbei. Doping verlangt Klarheit und Wahrheit, nach sauberen Abgrenzungen, wissenschaftlich gesicherten Untersuchungsverfahren und integren Kontroll und Berufungsinstanzen.“ (die Zeit, 7.8.1970)
1972 präzisierte Prof. Manfred Donike, verantwortlich für die deutschen Dopinganalysen, in einem Artikel in W. Hollmann, ‚Zentrale Themen der Sportmedizin‘, welche Mittel verboten sind. Er bezieht sich dabei auf die Regelung des DSB und IOC. Danach ist letztlich das entscheidende Argument deren Nachweisbarkeit:
„Das dritte Kriterium für die Aufnahme eines Wirkstoffes in eine spezifizierte Dopingliste, die zumindest theoretisch vorhandene Nachweismöglichkeit, läßt sich aus der allgemein gültigen pädagogischen Regel ableiten, daß die Aufstellung von nicht kontrollierbaren Verboten sinnlos ist. Auf die Dopinganalytik angewendet bedeutet das: Analytisch nicht nachweisbare Verbindungen können nicht in diese ausführliche Liste aufgenommen werden. Ein Beispiel hierfür sind die Steroidhormone, deren Nachweis – zur Zeit jedenfalls noch – Schwierigkeiten bereitet.“ Auf die anders lautenden Regelungen von IAAF und DLV geht er nicht ein.
Monika, 2010, Ergänzungen
